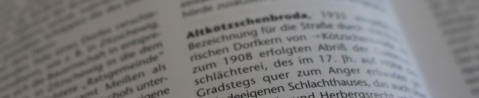Familie Aronade - Verlegeort: Clara-Zetkin-Straße 5
Dr. Berthold Aronade (1871–1938)
als „jüdisch“ verfolgt
Stolpersteininschrift:
HIER WOHNTE
DR. BERTHOLD
ARONADE
JG. 1871
GEDEMÜTIGT / ENTRECHTET
TOT 20. MÄRZ 1938
DRESDEN
Berthold Aronade wurde am 4. Januar 1871 in Antonienhütte (Kreis Kattowitz, Oberschlesien) als Sohn des Kaufmanns und Privatiers Aron Aronade und dessen Ehefrau Rosalie, geb. Becker, geboren. Er hatte einen Bruder, Otto Aronade (geb. 1881), der später als Arzt tätig war.
Berthold Aronade besuchte das Gymnasium in Groß-Strehlitz und studierte anschließend Rechtswissenschaften in München, Berlin, Zürich und Breslau. 1897/98 promovierte er an der Friedrich-Schiller-Universität Jena mit einer Dissertation zum Jesuitengesetz. Während seiner Studienzeit war er in Berlin gemeldet.
Am 16. Mai 1907 heiratete er in Hirschberg Katharina Sachs. Das Ehepaar hatte zwei Söhne, Günther und Kurt. In einer Phase zunehmenden politischen Antisemitismus unterstützte Aronade 1911 den Wahlfonds des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens.
Im Ersten Weltkrieg diente Aronade als Soldat und wurde bereits im November 1914 als Vizefeldwebel des Landsturm-Bataillons Kattowitz schwer verwundet.
Nach dem Krieg und der polnischen Besetzung Oberschlesiens verließ die Familie ihre Heimat. Ab dem 4. November 1920 lebte sie in Radebeul in der Sedanstraße 5 (heute Clara-Zetkin-Straße). Im Adressbuch wird Berthold Aronade als Kaufmann geführt. 1921 trat er als persönlich haftender Gesellschafter in die Firma Theodor Aust oHG in Dresden ein, einem Großhandel für Eisenwaren und Wirtschaftsbedarf.
Während der Weltwirtschaftskrise (1929–1931) wurde Aronade in mehreren Verfahren als Vertrauensperson eingesetzt. Über das Erleben der Machtergreifung 1933 durch die Familie ist wenig bekannt, sicher ist jedoch, dass auch die Aronades zunehmend von Ausgrenzung und Verfolgung betroffen waren.
Berthold Aronade nutzte seine juristische und wirtschaftliche Expertise, um anderen jüdischen Auswanderungswilligen bei Vermögens-, Steuer- und Grundstücksfragen zu helfen. Als anerkannter Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs blieb er zunächst von bestimmten antisemitischen Einschränkungen verschont und durfte weiterhin Mandanten bei Steuerbehörden und Amtsgerichten vertreten.
Mitte der 1930er Jahre zog das Ehepaar angesichts der zunehmenden Repressionen nach Dresden. 1938 wohnten sie auf der Schneebergstraße 25 nahe dem Großen Garten. Im Dresdner Adressbuch wird Berthold Aronade als „Wirtschaftsberater“ geführt.
Am 20. März 1938 starb Berthold Aronade im Stadtkrankenhaus Dresden-Löbtau im Alter von 66 Jahren. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Neuen Israelitischen Friedhof in Dresden.
Text und Bild: D. Ristau
Katharina Henriette Aronade, geb. Sachs (1883–1943)
als „jüdisch“ verfolgt
Stolpersteininschrift:
HIER WOHNTE
KATHARINA
ARONADE
GEB. SACHS
JG. 1883
INTERNIERT 1942
LAGER HELLERBERG
DEPORTIERT 1943
AUSCHWITZ
ERMORDET 3.3.1943
Katharina Henriette Aronade, genannt „Käthe“, wurde am 24. Juli 1883 in Hirschberg (heute Polen) als Tochter des Fabrikbesitzers Eugen Sachs und seiner Frau Anna geboren. Bis zu ihrer Hochzeit lebte sie in ihrer Heimatstadt und besuchte dort vermutlich die Schule.
1907 heiratete sie Berthold Aronade und zog mit ihm nach dem Ersten Weltkrieg nach Radebeul. Dort war sie zunächst Hausfrau und kümmerte sich um die Erziehung der Söhne Kurt und Günther. Während der Weltwirtschaftskrise führte Katharina Aronade ein eigenes Textilwarengeschäft, das sie vermutlich unter dem Druck der zunehmenden antisemitischen Verfolgung 1934/35 wieder aufgab. Kurz darauf zog die Familie nach Dresden.
Nach dem Tod ihres Mannes 1938 gab Katharina Aronade die Wohnung in der Schneebergstraße auf. 1939 lebte sie zunächst im Haushalt der ebenfalls verfolgten Mathilde Krumbiegel in der Lindenstraße 26, später war sie in der Mozartstraße 3 und schließlich in der Schillingstraße 19 gemeldet.
Hinweise auf ihre Situation in dieser Zeit finden sich in den Tagebüchern Victor Klemperers: Im August 1941 wurde Katharina Aronade wegen des Kaufs eines Uhrenarmbands zur Gestapo vorgeladen, dort „unflätig behandelt und geprügelt“, sodass sie „zwei Tage krank“ war. Klemperer schilderte zudem ihren körperlichen Verfall – die vormals beleibte Frau sei „vollkommen entfleischt, absolut dürr“, habe aber dennoch Mut und Zuversicht bewahrt. Medizinische Unterlagen bestätigen, dass sie infolge der Verfolgung unter Herz- und Nervenbeschwerden sowie einer Gehbehinderung litt.
Ab 1942 musste Katharina Aronade in einem sogenannten „Judenhaus“ in der Altenzeller Straße 41 leben. Dort war sie sozial isoliert und weiteren Schikanen ausgesetzt.
Am 24. November 1942 wurde sie zwangsweise in das „Judenlager Hellerberg“ im Dresdner Norden verlegt – ein Zwangsarbeiterlager der Firma Zeiss-Ikon. Eine Filmaufnahme zeigt ihren Koffer, auf dem der vorgeschriebene Zwangsvorname „Sara“ vermerkt war.
Am 2. März 1943 wurde Katharina Aronade gemeinsam mit den anderen Lagerinsassen vom Güterbahnhof Dresden-Neustadt nach Auschwitz deportiert, wo sie am 3. März 1943 unmittelbar nach der Ankunft ermordet wurde.
Text und Bild: D. Ristau
Kurt Aronade (1915–1993)
als „jüdisch“ verfolgt
Stolpersteininschrift:
HIER WOHNTE
KURT ARONADE
JG. 1915
FLUCHT 1939
DÄNEMARK
SCHWEDEN
Kurt Walter Aronade wurde am 27. Januar 1915 als Sohn von Berthold und Katharina Aronade in Kattowitz geboren. Nach dem Umzug der Familie nach Radebeul besuchte er von 1921 bis 1925 die Schillerschule und anschließend das Realgymnasium in der Lößnitz, das er mit der mittleren Reife abschloss. Seine Bar Mizwa feierte er am 31. August 1929.
Trotz zunehmender antisemitischer Diskriminierung konnte Kurt Aronade 1936 die Gesellenprüfung als Heizungsinstallateur sowie eine Schweißerprüfung erfolgreich ablegen. Er engagierte sich aktiv in der jüdischen Gemeinde Dresdens, insbesondere im Jugendlehrhaus, wo er Vorträge hielt und Veranstaltungen mitorganisierte.
Nach den Novemberpogromen 1938 wurde Kurt Aronade ins Konzentrationslager Buchenwald verschleppt und erst am 22. Dezember 1938 entlassen. Im März 1939 emigrierte er, vermutlich zusammen mit seinem Bruder Günther, in die Niederlande.
Während des Zweiten Weltkriegs hielt sich Kurt Aronade zunächst in Dänemark auf, floh jedoch nach der deutschen Besetzung 1940 weiter nach Schweden. Dort lebte er in Björskog und arbeitete 1944 als Arbeiter. Im selben Jahr wurde seine Tochter Ruth geboren, die gemeinsame Tochter mit Susi Gabriele Wergert.
Kurt Aronade überlebte als einziger seiner Familie die Shoah. 1949 wanderte er mit seiner Familie nach Israel aus. Er starb am 16. Januar 1993 in Netanya, wo er auch seine letzte Ruhestätte fand.
Text und Bild: D. Ristau
Günther Aronade (1918–1944)
als „jüdisch“ verfolgt
Stolpersteininschrift:
HIER WOHNTE
GÜNTHER
ARONADE
JG. 1918
‚SCHUTZHAFT‘ 1938
KZ BUCHENWALD
FLUCHT 1939 HOLLAND
INTERNIERT WESTERBORK
DEPORTIERT 1944
AUSCHWITZ
ERMORDET
Günther Ernst Aronade wurde am 19. März 1918 in Kattowitz geboren. Wie sein Bruder Kurt besuchte er die Schulen in Radebeul. Seine Bar Mizwa feierte er am 28. März 1931.
Als talentierter Tischtennisspieler gehörte Aronade zunächst dem Radebeuler Ballspiel-Club an. Nach dem Ausschluss von Juden aus allgemeinen Vereinen trat er dem jüdischen Sportverein Schild Dresden bei. 1938 wurde er Württembergischer Meister bei einem Turnier jüdischer Sportvereine.
Um 1938 lebte er in Heidelberg, vermutlich für ein Dolmetscherstudium. Im Zuge der Novemberpogrome wurde Günther Aronade ins Konzentrationslager Buchenwald verschleppt und erst am 27. Januar 1939 entlassen. Kurz darauf verließ er Deutschland und emigrierte in die Niederlande. Ab dem 8. März 1939 lebte er im Werkdorp Wieringen, einer Ausbildungsstätte für jüdische Auswanderer nach Palästina. Nach der Schließung des Werkdorps 1941 zog Aronade nach Amsterdam. Dort heiratete er im Juli 1942 Elsa Heymann. Er arbeitete unter anderem als Heizer für den von den deutschen Besatzungsbehörden eingesetzten Amsterdamer Judenrat.
Am 20. Juni 1943 wurde Günther Aronade verhaftet und ins Lager Westerbork gebracht. Im September 1943 gelang ihm die Flucht. Beim Versuch, ins unbesetzte Südfrankreich zu gelangen, wurden seine Frau und er jedoch gefasst und in das Gefängnis von Moulins eingeliefert. Günther Aronade wurde anschließend ins Lager Drancy überstellt. Am 10. Februar 1944 deportierte man ihn von dort nach Auschwitz. Dort wurde er als arbeitsfähig eingestuft, erhielt eine Häftlingsnummer tätowiert und musste Zwangsarbeit leisten. Im Lager infizierte er sich mit Typhus. Das genaue Datum und die Umstände seines Todes sind unbekannt.
Seine Ehefrau Elsa Aronade überlebte den Holocaust, emigrierte nach Israel und setzte sich später für das Andenken an Günther Aronade ein.
Text und Bild: D. Ristau